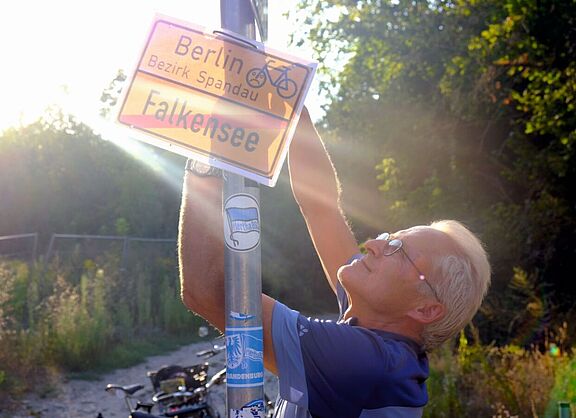Geschützte Radfahrstreifen: Trennelemente
Welche Trennelemente an geschützten Radfahrstreifen gibt es und wie sind sie zu bewerten? Dieses Papier bietet einen Überblick.
Das ganze Papier mit Beispielen ist hier.
Zusammenfassung:
Geschützte Radfahrstreifen sind Radwege auf der Straße, die durch Trennelemente vom Autoverkehr getrennt sind. Es also geht nicht um bloße Markierungen (auch wenn diese gewissen Schutz bieten) und nicht um Hochbordradwege (auch wenn diese nicht immer optimalen Schutz bieten). Mehr allgemeine Infos gibt es im ADFC-Positionspapier.
Es gibt sehr verschiedene Trennelementen, und die Straßenbehörden in Berlin experimentieren – auch nach eigener Aussage – durchaus noch, was wo die beste Lösung ist. Das drückt sich auch darin aus, dass es an ähnlichen Stellen ganz unterschiedliche Varianten gibt. Eine größere Einheitlichkeit wäre für alle am Verkehr Beteiligten wünschenswert. Vor diesem Hintergrund will diese Übersicht die Möglichkeiten vorstellen sowie Vor- und Nachteile aufzeigen. Es handelt sich hier aber nicht um eine umfassende Bewertung oder ein abschließendes Urteil, sondern um vorläufige Bewertungen und Betrachtungen auf Basis u.a. von Diskussionen beim ADFC und auf Twitter.
Auch wenn der Fokus dieser Übersicht auf Trennelementen liegt, bleibt zu beachten, dass vor allem der Raum bzw. die Radwegbreite Sicherheit schafft, weil dadurch der Abstand zu den Autos größer ist. Auch mit Trennelementen ist es kein Vergnügen, einen Meter neben einem 40-Tonner zu fahren. Genug Platz braucht es zudem für gute Trennelemente. An engen Straßen (z.B. Frankfurter Allee für drei Fahrstreifen) gibt es einen Zielkonflikt zwischen der nutzbaren Radwegbreite und guter Trennung. Erst ab gewissen Breiten kann der Radweg außerdem von allen Räumfahrzeugen bzw. notfalls von Krankenwagen genutzt werden.
Trennelemente sollen Radfahrenden Sicherheit geben. Ihr Hauptzweck ist also, sowohl fahrende als auch parkende Autos vom Radverkehr fern zu halten. Grundsätzlich gilt dabei wohl, dass stärkere und größere Trennelemente mehr Schutz bieten als schwächere und kleinere. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch für Radfahrende jedes Element nahe des Fahrwegs Unfallgefahren birgt. Harte Pfosten zum Beispiel schützen besser vor Durchbrüchen von Autos als flexible Pfosten, könnten aber auch eher Stürze mit dem Rad verursachen oder verschlimmern. Sicherheit umfasst schließlich auch die Frage, wie häufig Autos gegen die Trennelementen fahren, auch da dadurch Radfahrende gefährdet werden. Wichtig wäre es, diese unterschiedlichen Gefahren mit Unfallzahlen zu entkräften oder zu erhärten.
Die Sichtbarkeit der Trennelemente trägt zur Sicherheit bei. Allerdings werden nachweislich auch auffällige, sogar nach innen versetzte Pfosten von Autos gerammt (z.B. Frankfurter Allee Ecke Jungstraße oder Lichtenberger Straße Ecke Singerstraße). Zugleich ist die Frage, wo auffällige Markierungen an ihre Grenzen stoßen, entweder weil der Effekt sich in der Masse irgendwann abnutzt, oder wenn durch die Nutzung teils auffälliger Elemente die übrigen, unauffälligeren umso weniger wahrgenommen werden. Auch hier wäre mit empirischen Daten zu klären, wie die Effekte sind und was eine optimale Gestaltung ist.
Einige Faktoren für die Trennelemente lassen sich vom ADFC nicht bewerten, v.a. die Kosten bzw. der Errichtungsaufwand, zum Teil auch die Haltbarkeit. Dieser Punkt scheint jedenfalls – auch angesichts knapper finanzieller und personeller Ressourcen in den Ämtern – nicht unbedeutend.
Geschlossene Trennung mit durchgehenden Trennelementen hält nicht nur den Autoverkehr vom Radweg ab, sondern macht auch jedes Ausscheren des Radverkehrs (sofern der Radstreifen nicht benutzungspflichtig ist) unmöglich. Gerade bei schmaleren Radwegen ist dies nicht immer wünschenswert, zumal durchgehende Elemente keine höhere Sicherheit gegenüber (eng stehenden) Pfosten bieten dürften. Eine offene Trennung mit (eher) lockeren Elementen (z.B. Pfosten oder flache Trenner mit Abständen) erhält demgegenüber die Durchlässigkeit, was zumindest in Not- oder Stausituationen hilfreich sein kann.
Die Höhe der Trennelemente wird momentan sehr unterschiedlich gehandhabt, wobei unklar ist, wann momentan was eingesetzt wird (z.B. warum an der Hasenheide hohe Pfosten stehen, aber an der Gitschiner Straße nur flache Bodenelemente).Bei den bisher erprobten flachen Elementen scheinen die grünen Kunststofftrenner (z.B. Gitschiner Straße) am besten, weil sie zugleich recht auffällig sind (jedenfalls mehr als bloßer Beton wie teils auf der Oberbaumbrücke), aber nicht so aufdringlich wie mit rot-weißen Signalmarkierungen. In jedem Fall sollte bei größeren Bodenelementen auf der Autoseite eine senkrechte Kante bestehen (die im Prinzip nicht überfahren werden kann), auf der Radseite aber eine schräge, da dies das Unfallrisiko senken dürfte. Flache Elemente könnten übersehen oder – wenn besonders klein – von Schnee oder Blättern überdeckt werden. Kleine Bodenelemente (wie am Kottbusser Damm) bewirken wohl mehr als bloße Markierungen, sollten aber weiterhin nur ergänzend zu Parkplätzen zum Einsatz kommen.
Ein zentrales Problem bleiben Kreuzungen und Ausfahrten. Hier ist bisher keine befriedigende Lösung erkennbar, weil es immer zu gefährlichen Situationen mit Autos kommen kann. Unverständlich ist aber jedenfalls die fehlende Einheitlichkeit der Sicherung. An der Frankfurter Allee (Südseite) zum Beispiel sind die Gestaltungen ohne erkennbaren Sachgrund unterschiedlich, was die Verstärkung der Sicherung oder auch die Abstände der Elemente zu den Kreuzungen angeht. Paradoxerweise ist teils gerade an Kreuzungen der Schutz geringer, wenn zum Beispiel Parkplätze vorher enden (z.B. Kantstraße oder Karl-Marx-Alle Ecke Otto-Braun-Straße). Wo Parkstreifen bestehen, sollte der Streifen an der Kreuzung möglichst weiträumig freigehalten werden, um gute Sichtachsen beim Queren zu haben (wie an der Lichtenberger Straße Ecke Singerstraße).
Parkplätze rechts der Radspur sind ein weiteres großes Problem für den Einsatz von Trennelementen. Jeder Parkplatz erfordert – um das Ein- und Ausparken zu ermöglichen – ein weiträumiges Aussetzen der Trennelemente und führt zu den Radweg querenden Autos. Deshalb sollten immer möglichst wenige oder keine Parkplätze rechts von geschützten Radfahrstreifen bestehen. Wo Parkplätze nicht zu vermeiden sind, sollten die Trennelemente zumindest so nah bis an den Parkplatz gehen wie möglich.
Nicht ganz außer Acht sollte bei allem notwendigen Fokus auf Sicherheit und Auffälligkeit bleiben, welche Lösung schöner ist. Zum Beispiel sprachen sich auf Twitter die meisten Menschen für Blumenkübel aus, was wohl auch ästhetische Gründe hat. Flache Bodenelemente haben den Vorteil, optisch dezenter zu sein.
Im Folgenden werden Beispiele für Trennelemente aufgelistet und bewertet, wobei die Reihenfolge ungefähr von starker zu schwacher Trennung verläuft.
(Fortsetzung siehe ganzer Text)